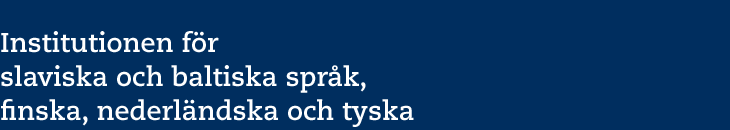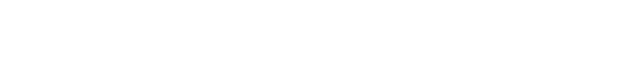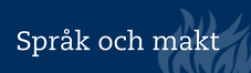Stefan Neuhaus (Universität Koblenz Landau): Welcome to Heterotopia. Reisende in Romanen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Der postmoderne Mensch ist aus seinen früheren Bezügen gelöst worden, er hat Sicherheiten verloren und Freiheiten gewonnen. Früher waren lineare Erwerbsbiographien die Regel, heute sind sie die Ausnahme; früher war das Leben im Familienverbund die Regel, heute dominiert der Single-Haushalt. Von diesen Veränderungen ist auch das Reisen als Wechsel von Orten und als Bewegung durch Räume betroffen. Es lassen sich bestimmte Eigenschaften von Reisenden und Normierungen des Reiseverhaltens unterscheiden, die sich im Laufe der Moderne und Postmoderne herauspräpariert haben und die in eine neue Konzeption einer ‚ort-losen‘ Heimat münden, die mit Foucaults Begriff der Heterotopie gefasst werden kann.
Mit Zygmunt Bauman lassen sich Touristen und Vagabunden unterscheiden; erstere dürfen reisen, letztere müssen reisen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch die Figuren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sind ausgesprochen mobil und lassen sich diesen Gruppen zuordnen. Die Figuren der sogenannten zweiten Welle der Popliteratur, deren Beginn das Erscheinen von Christian Krachts Roman Faserland im Jahr 1995 markiert, sind zwar Touristen, aber trotzdem unglücklich, denn sie leiden unter ihrer Ortlosigkeit, die als eine Nichtzugehörigkeit empfunden wird. Solche Figuren, die man auch als postadoleszent bezeichnen kann, finden sich beispielsweise auch und viel ungebrochener bei Judith Hermann oder Benjamin von Stuckrad-Barre. Ein anderer Typus ist der an globalen Entwicklungen leidende Nomade, wie er sich etwa in Ilija Tronanows Romanen Der Weltensammler und EisTau oder in Raoul Schrotts Roman Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde findet. Auch Christian Kracht zeichnet mit 1979 und Imperium Figuren, die durch zur Heterotopie aufgeladene Räume reisen und auf der Suche bleiben.
Das Zusammensein mit anderen ändert nichts oder wenig an der sozialen Bindungslosigkeit einerseits und der neoromantischen Sehnsucht nach sozialen Bindungen andererseits, die der zentrale Auslöser der Suchbewegung ist. Reisen und Alleinsein schließen sich in Thomas Glavinics Roman Die Arbeit der Nacht sogar nicht nur nicht aus, sondern bedingen einander. Eine signifkante Abweichung entsteht, wenn ironisch erzählt wird. Christian Kracht ist dafür bereits ein Beispiel, ebenso und auf andere Weise Wolf Haas, etwa mit seinen Romanen Verteidigung der Missionarsstellung und Brennerova, außerdem und wieder auf andere Weise Felicitas Hoppe mit Hoppe und zuletzt mit Prawda.
Am Beispiel einiger der genannten Texte soll gezeigt werden, dass die gesellschaftlichen Veränderungen hin zu einer Single-Gesellschaft, zu einer ‚Me-Generation‘ mit eher losen, durch Arbeitswelt und Ökonomie bestimmten Sozialbeziehungen zu einer Konzentration auf das eigene Ich und damit zu einenm gewachsenen Hedonismus und Narzissmus geführt haben, der gespiegelt und von einigen der Texte zugleich wieder kritisch reflektiert wird. Veränderungen des Reisens im Medium der Literatur weisen also auf einen tiefgreifenden Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft.
Stefan Neuhaus, geb. 1965. Studium der Germanistik in Bamberg und Leeds. 1996 Promotion, 2001 Habilitation, 2005 Ehrendoktorwürde der Universität Göteborg. Professuren an den Universitäten Oldenburg und Innsbruck. Seit 2012 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz-Landau, Standort Koblenz. Monographien: Freiheit, Ungleichheit, Selbstsucht? Fontane und Großbritannien (1996); Fontane-ABC (1998); Das verschwiegene Werk. Erich Kästners Mitarbeit an Theaterstücken unter Pseudonym (2000); Literatur und nationale Einheit in Deutschland (2002); Das Spiel mit dem Leser. Wilhelm Hauff: Werk und Wirkung (2002); Sexualität im Diskurs der Literatur (2002); Revision des literarischen Kanons (2002); Literaturkritik (2004); Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers und seine Vorgeschichte(n) (2004); Literaturvermittlung (2009); Märchen (2. Aufl. 2017); Grundriss der Literaturwissenschaft (5. Aufl. 2017); Grundriss der Neueren deutschsprachigen Literaturgeschichte (2017). Zahlreiche (Mit-)Herausgeberschaften z.B. der Werke und Briefe Ernst Tollers (2015/2018 im Wallstein-Verlag Göttingen) oder verschiedener Reihen, etwa „Studien zu Literatur und Film der Gegenwart“ im Tectum-Verlag Marburg und, gemeinsam mit Oliver Jahraus, „Film – Medium – Diskurs“ bei Königshausen & Neumann, Würzburg.